Andreas Vey und ich begrüßen uns mit einer Umarmung. Seine Musik, die Empfehlung eines Bekannten. Der Entschluss, dem Rat zu folgen und nicht enttäuscht zu werden, führt mich hierhin. Wieder nach Berlin, wieder ist es warm und erneut geht es um Musik.
Wir quatschen lange an diesem Nachmittag. Also nehmt euch die Zeit, schenkt dem Interview und somit der Musik eure volle Aufmerksamkeit. Es ist ein sehr echtes Gespräch. Was die Musik angeht, ein guter Freund spricht vom Sommersong des Jahres, nachdem er Bigger Than Us gehört hat. Wenn das kein Prädikat ist!
Dieser Song ist auch auf der kommenden Debüt-EP Things I Might Never Know zu finden. Wir haben noch Platz, also setzt euch und genießt das folgende Gespräch.
Moin!
Wie war deine Nacht?
Andreas: Gut (lacht)! Ich habe gestern gearbeitet und ein befreundeter Musiker hat mich nach der Schicht spontan gefragt, ob wir noch was trinken gehen wollen. Und dann haben wir ein Bierchen getrunken, dann zwei Bierchen und dann sind wir irgendwann in der Bravor Bar gelandet. Das ist so eine alte Berliner Bar und da sind wir dann so ein bisschen versackt – bis fünf Uhr morgens. Deswegen bin ich auch etwas verklatscht, aber es war sehr schön! Aber mit jeder Euphorie kommt ja auch ein leichtes Tief (lacht auf).

Arbeitstitel: Auf ein Croissant mit Andreas Vey
Stellen wir dich doch einmal vor:
Wer ist Andreas Vey?
Eben dieser: Ich bin Singer-Songwriter, wohne in Berlin und komme aus dem Kreis Lippe. Also aus der Mitte von Deutschland, so richtig vom Dorf. Ich habe mein Leben lang nur auf dem Dorf gelebt und bin dann vor drei Jahre nach Berlin gezogen, um mich ausschließlich der Musik zu widmen.
Berlin
Ist dieser Weg noch immer die logische Konsequenz für einen Musiker – nach Berlin zu kommen?
Andreas: Ich habe mich ehrlich gesagt auch immer dagegen gesträubt, das so zu sehen. Aber ich glaube auch aus einer Angst vor der Stadt. Die große Stadt hat mich früher immer extrem beängstigt. Ich kriege schnell Panikattacken, vor allem in großen Menschenmengen. Und ich konnte mir das früher, ehrlich gesagt, einfach gar nicht vorstellen – in einer großen Stadt zu leben. Dann bin ich mal nach Köln gezogen, habe da aber auch nur kurz gelebt. Dann habe ich in Paderborn studiert und immer gedacht, ich kann das aus so einer kleinen Zelle heraus machen.
Aber jetzt mit dem Schritt nach Berlin hat sich gezeigt, dass es eben einfach ein Gamechanger ist. In der Hinsicht, dass du hier einfach ein enormes Umfeld an Leuten hast, die das Gleiche machen, oder das gleiche Ziel verfolgen wie ich. Man kann sich austauschen, man lernt sich kennen, das kannst du nicht durch “eine E-Mail schreiben” oder irgendwas vergleichbares ersetzen. Es kommt eins zum anderen, das ist mir zumindest vorher nie passiert.
Du lernst halt Produzenten und andere Musiker kennen. Du lernst auch in viel kürzerer kurzer Zeit viel mehr, weil du Gleichgesinnte hast, die vielleicht eine andere Sicht haben. Man kann sich gegenseitig inspirieren, voneinander profitieren. Der eine hilft dem anderen mal und so weiter und so fort. Wo ich herkomme ist der logische Weg: Du studierst oder machst ‘ne Ausbildung und hast ‘nen Job mit 30 und bleibst dann da in der Firma. Das ist noch so der klassische Weg. Und in so einem Umfeld habe ich mich dann eher wie ein Alien gefühlt.
Witzigerweise hatte ich gestern auch noch ein Gespräch in der Bar – dass es ja voll der Luxus ist, aus seiner Leidenschaft einen Beruf zu machen. Und ab wann sagt man, dass man das beruflich macht oder ob es ein Hobby ist? Das ist nach wie vor ein spannendes Thema. Aber die Frage wurde mir früher sehr oft gestellt, warum ich das nicht einfach als Hobby mache. Und jetzt hier in Berlin stellt sich die Frage meist nicht. Weil es viele gibt, die das machen und das selbstverständlich ist: Ey, das ist halt mein innerer Drang Musik zu machen und ich muss mich nicht ständig dafür rechtfertigen, dass ich das machen will. Nur weil es im Zweifel vielleicht Spaß macht.
Du hast in einem deiner Social Media-Beiträge unter anderem das allgemeine oder veraltete Gefühl von Männlichkeit zum Thema gemacht. Und bist für dein Erscheinungsbild auch hier in Berlin angefeindet worden.
Wie gehst du mittlerweile damit um?
Andreas: Also ich habe mir schon früher, mit 18, ein bisschen Rouge auf die Wange gemacht. Als ich noch nicht hier gelebt habe. Aber damals hatte ich das geleugnet, wenn mir Leute das gesagt haben: “Ey, du hast doch Rouge auf der Wange!” “Nee, auf gar keinen Fall!”
Und ich habe mich auch mit dieser alten Männlichkeitsschablone gemessen. Dass man halt gewisse Stereotypen erfüllt. Sowohl optisch natürlich, als auch immer cool sein, beherrscht sein, alles unter Kontrolle zu haben. Männer sind Weicheier, wenn sie Emotionen zeigen, “Schwul” ist ein Schimpfwort, das gab es halt auch in meiner Jugend. Als Teenager ist es schwer zu seiner eigenen Identität zu stehen. Man versucht immer noch mehr zu dem zu passen, was der Standard ist.
Selbst als ich vor drei Jahren nach Berlin gezogen bin, habe ich das vor meiner damaligen Freundin oder auch guten Freunden mehr oder weniger geleugnet. Irgendwann gab es aber den Moment, da habe ich mir gesagt: “Ey, das ist doch voll der Quatsch! Steh doch einfach dazu!” Und habe dann angefangen, es einigen Leuten zu sagen, dass ich damit offener umgehen möchte. Und die haben mir dann gesagt, dass die das schon lange wussten. Seitdem bin ich viel selbstbewusster und gehe einfach aufrechter durchs Leben und bin mehr mit mir im Reinen.
Vor ein paar Wochen hatte ich eine Situation in der U-Bahn, als sich eine Gruppe Jugendlicher neben mich gesetzt hat. Die haben mich gefragt, ob ich schwul bin und da habe ich gar nicht drauf geantwortet. Und dann meinten sie, sie hassen Schwule – das waren halt wirkliche homophobe Idioten. Sowas erlebt man auch. Aber insgesamt ist es halt einfach schön, das zu teilen. Das Schönste, was ich damit bewirken kann, ist hier und da jemanden zu inspirieren.
Also mir ist es wichtig, dass ich nicht mit erhobenem Finger durch die Gegend laufe. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alte Männlichkeitsbild nur scheiße ist.
Und jemand, der gerne ein dickes Auto fährt und zum Beispiel dicke Muskeln hat – der dieses alte Männerbild fühlt und gerne macht, dann ist das auch voll okay.Aber ich bin halt so wie ich bin und vielleicht kann ich damit den einen oder anderen inspirieren. Und jemand denkt sich:
“Cool, kann ich auch machen!” Und ist trotzdem noch ein Mann.
In Strangers thematisierst du den ungesunden Umgang zweier Menschen miteinander.
Was meinst du, woher rührt solch ein Verhalten?
Andreas: In erster Linie aus einer krassen Unsicherheit. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen, mich eingeschlossen, es schwer haben, Zeit mit sich selbst zu verbringen. Mal ganz alleine und ganz in Ruhe zu sein. Ohne permanent distracted zu sein, von seien es jetzt soziale Medien oder ständig Leute um sich rum zu haben. Gerade in so einer lebendigen Stadt wie Berlin kann man sich ständig mit Leuten umgeben. Aber die Frage ist dann halt, wie geht man da miteinander um? Wie tief sind diese Beziehungen? Ohne dass ich das jetzt schlecht reden möchte, das man mal oberflächliche Beziehungen hat. Das kann ja auch total schön sein.
Ich hatte mal das Gefühl, so ein, zwei Beziehungen gehabt zu haben, die eher toxisch waren. Wo man sich gegenseitig verletzt hat, teilweise auch wissentlich. Auf einer emotionalen Ebene. Und da habe ich mich einfach gefragt: “Warum eigentlich?” Der Song ist aus dieser Frage entstanden, ich habe jetzt auch keine Antwort darauf. Der Song ist nicht die Antwort, sondern eher die Frage.
Sometimes it’s strange
How we use each other
To feel better about ourselves
Das ist eigentlich die Essenz des Songs. Und gleichzeitig bin ich da wohl auch einer von vielen, der Probleme hat, sich zu binden. Eine Art Bindungsangst. Woher auch immer sie rührt. Dass man Menschen immer wieder nah an sich ranzieht, um dann halt auch eine Bestätigung zu bekommen und sie dann aber auch wieder wegstößt, weil sobald es wirklich tiefer geht, man es mit der Angst zu tun bekommt. Das ist das Thema des Songs.
JukeBox
Quelle: YouTube, Andreas Vey
Quelle: YouTube, Andreas Vey
Fool For Your Light – deine noch aktuelle Single!
Das hat mich stark an Keane erinnert und bei Joanna habe ich kurz an Lewis Capaldi gedacht.
Eine ganz klassische Frage:
Woher ziehst du deine Inspiration? Textlich, wie auch musikalisch.
Andreas: Oh, das ist sehr divers! Unter anderem auch aus dem Pop. Ich befasse mich schon mit der aktuellen Popmusik. Lewis Capaldi ist tatsächlich jemand, den ich ganz zu Beginn seiner Karriere auch gehört habe. Irgendwann hat es mich dann nicht mehr erreicht, weil es zu viel das Gleiche war. Zu viel Heartbreak, zu der Zeit hat es mich nicht mehr so gecatcht, abgesehen davon, dass der Typ natürlich ‘ne brachiale Stimme hat!
Also super viel. Von ganz alten Künstlern, die mich schon mein Leben lang begleiten, zum Beispiel Queen, Beatles. Das sind vom Songwriting Dinger, die mich immer noch sehr beeinflussen. Jeff Buckley habe ich unfassbar viel gehört, aktuell habe ich auch viel James Blake gehört, Frank Ocean, also ich könnte wirklich unendlich viel aufzählen.
Alles kann mich inspirieren, vor allem, wenn es irgendwas ist, was minimal neu ist. Wenn ich das so noch nicht gehört habe, ziehe ich daraus Inspiration. Textlich auch aus Literatur. Eine Zeit lang habe ich viel Hermann Hesse gelesen. Philosophisches, ich lese auch viel und da ziehe ich auch textlich was her. Es kann überall herkommen. Auch aus Gesprächen mit Freunden, mit Fremden, auch Bekanntschaften.
Inspiration kann echt überall herkommen. Wenn mich was berührt. Wenn ich sage, ich kriege Gänsehaut, habe geweint, solch extreme Reaktionen kommen auch eher seltener vor. Aber wenn ich denke, krass, das berührt mich. Dann hast du auf einmal so einen Energieschub, auch wenn du vielleicht total platt bist. Und dann merke ich immer, okay, jetzt habe ich Bock was zu schreiben, dadurch inspiriert. Und was dann hinterher dabei rauskommt – who knows?
Songs über Trennungen schreibe ich witzigerweise in der Regel Monate danach. Und nicht in dem Moment. In dem Moment bin ich einfach nur wahnsinnig deprimiert und leer. Joanna zum Beispiel habe ich ein halbes Jahr nach der Trennung geschrieben. Als ich meinen Frieden damit gemacht habe. Dieser Song hat das für mich besiegelt. Dass ich gesagt habe, ich vermisse diesen Menschen und es hat mir sehr, sehr viel bedeutet, aber ich habe meinen Frieden damit gemacht, dass es ist, wie es ist. Und das drückt dieser Song für mich aus, das war in dem Moment total ehrlich. Das hat sich sehr, sehr gut angefühlt, diesen Song zu schreiben. Manchmal sind es auch einfach so Lebensituationen. Da gibt es keine eine Antwort drauf.
Auf deinem Social Media-Kanal sagst du über dich, dass du sehr introvertiert bist. Du teilst aber auch sehr persönliche Gedanken, in Form deiner iPhone-Notizen.
Ist diese Form der Kommunikation auch noch ein zusätzliches Ventil abseits der Musik für dich?
Andreas: Ja. Genau aus dem Grund, dass ich eher introvertiert bin. Und nicht so jemand, der viel rumrennt und seine Gedanken preisgibt. Da habe ich mir gedacht, ich kann diese Social Media-Plattform, die ja auch viel positives haben kann, einfach mal nutzen, um mit Menschen ehrliche Eindrücke aus meinem Seelenleben zu teilen. Einfach nur aus der Ich-Perspektive, wie ich gewisse Dinge erlebt habe oder fühle. Und habe gemerkt, dass die Reaktionen und die Resonanz darauf sehr, sehr positiv ist. Sehr viele, die mir schreiben, dass sie sich verstanden fühlen, dass sie sich nicht alleine fühlen. Das fand ich eigentlich am schönsten.
Das hat mich darin bestärkt, das weiterzumachen. Das wiederum gibt mir das Gefühl nicht alleine zu sein. Das aufzuschreiben ist einfach schon ein heilender Prozess, Dinge einfach mal zu veräußern. Und nicht nur in seinem Kopf so ein riesiges Cluster an Gedanken zu haben, die ein riesiges Chaos oder eine riesige Wolke ergeben. Das einfach mal rauszulassen. Aber das dann auch noch zu teilen, das ist erstmal beängstigend, weil es ja oft nicht die angenehmsten Sachen sind, die ich preisgebe. Doch es fühlt sich irgendwie richtig an. Ein bisschen Mut gehört zum Künstler sein auch dazu. Sich preiszugeben.
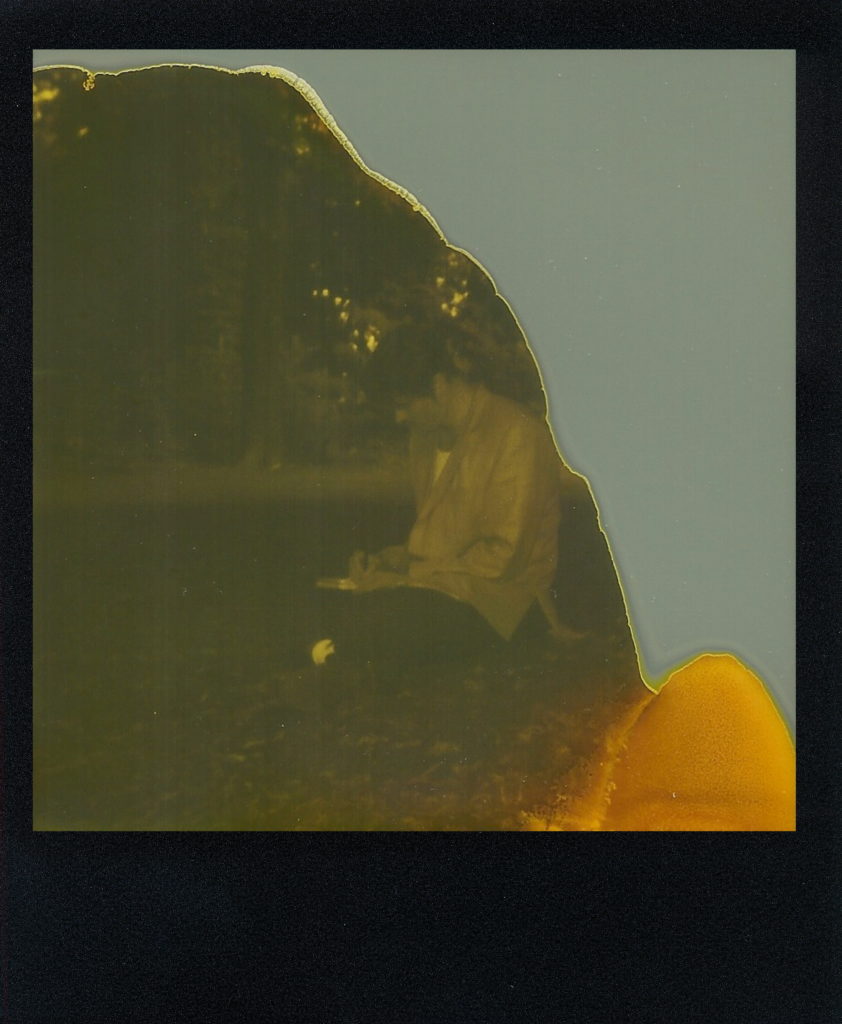
Ich habe früher viel mehr in großen Metaphern geschrieben.
Was sind die einfachen Dinge, die dich glücklich machen?
Andreas: Morgens ‘nen Kaffee trinken. Tatsächlich an der frischen Luft Sport machen. Ballsport. Ich habe früher viel Basketball gespielt. Das ist etwas simples, was mich glücklich macht. Oder mit Freunden einfach ein Bierchen trinken. Sich gut unterhalten. Spazieren gehen in der Natur, liebe ich. Ich komme ja auch wirklich vom Dorf. Das habe ich früher jeden Tag gemacht, mich viel in der Natur aufgehalten. Oder Fahrrad fahren. Und ein gutes Buch am Abend.
Ein letzter Blick zurück auf den sonnigen Nachmittag im Park …
Star Wars oder Star Trek?

Es ist “Der Herr der Ringe”!
Jeder Person, die das hier gelesen hat, wünsche ich einen guten Start ins Wochenende, vielleicht war dieses Gespräch auch abseits der Musik bereichernd. Die Musik von Andreas ist auf jeden Fall ein neues Juwel im Pop-Universum.
Wer sich über die Qualität der Bilder wundert, dieses Mal ist ein längst abgelaufener Film, noch vom Impossible Project, verwendet worden. Die Third Man Records-Edition. Ich schließe hier mit einem passenden (& abgekürzten) Zitat, welches das Interview schön beendet:
Visuelle Reize können auch inspirierend sein.
Das ist einfach mein Ventil – Musik.
Andreas Vey.



